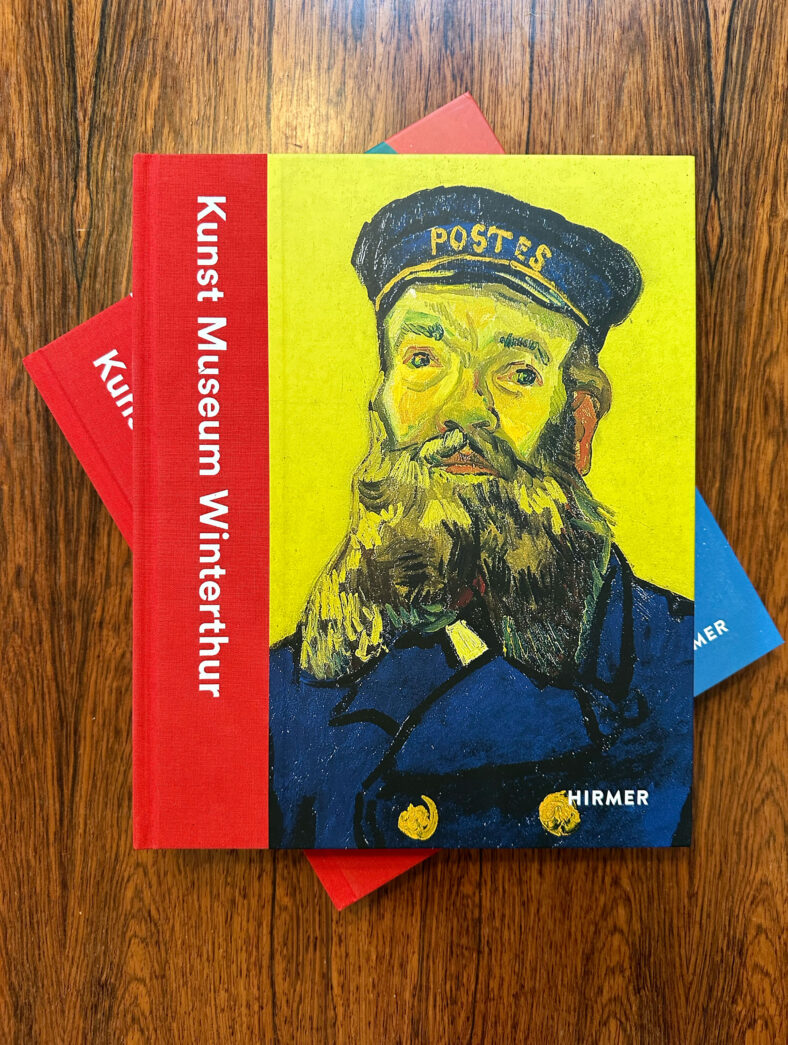Wiedereröffnung Kunst Museum Winterthur | Reinhart am Stadtgarten

Aussenansicht Kunst Museum Winterthur | Reinhart am Stadtgarten
Foto: Georg Aerni
Am 1. März 2025 öffnet das Kunst Museum Winterthur | Reinhart am Stadtgarten seine Pforten. Neu kann das Gebäude sowohl von der Stadt- als auch von der Parkseite her betreten werden. Die architektonische Neugestaltung mit skulpturalem Akzent von Ayşe Erkmen und Heike Hanada wird mit Leuchtkörpern von Koenraad Dedobbeleer ergänzt.
Das in die Jahre gekommene Ausstellungsgebäude, ein ehemaliges Schulhaus aus dem 19. Jahrhundert, wurde in einem innovativen Verfahren neugestaltet: Anstelle eines klassischen Architekturwettbewerbs wurden Teams von Kunstschaffenden und Architekt:innen eingeladen, den Eingangsbereich des Museums neu zu denken. Das Siegerprojekt entstand in Zusammenarbeit der in Berlin lebenden türkischen Künstlerin Ayşe Erkmen und der Berliner Architektin Heike Hanada. In einjähriger Bauzeit realisiert, besticht es durch einen markanten skulpturalen Akzent zur Stadtseite hin.
Im Innern verbindet es plastische und architektonische Elemente in geradezu symbiotischer Weise zu einer begehbaren minimalistischen Skulptur. Gleichzeitig öffnen subtile Eingriffe das Museum zum Stadtgarten und lassen den Aussenraum als fliessende Bewegung mit dem Innern erfahren.
«Ziel war eine permanente räumliche Installation in Form einer künstlerischen Überarbeitung des Foyers und seiner Hauptzugänge. Neu an diesem Verfahren war die Vorbedingung, ein interdisziplinäres Team aus Kunst und Architektur zu bilden. Die Grenze zwischen den beiden Disziplinen ist damit fliessend. In der Folge entwickelte sich ein Projekt, das sich vom Foyer ausgehend von Innen nach Aussen bzw. von Unten nach Oben ausdehnt. Es wurde also nicht wie allgemein üblich zunächst eine städtebauliche Idee oder ein Gesamtkonzept für das Denkmal erarbeitet, sondern das Raumkonzept bestimmte vom zentralen Innenraum ausgehend nach und nach die angrenzenden Raumschichten. Es entstand eine Treppen- und Stufenkomposition aus Ortbeton, die sich quer bzw. parallel zum Gebäude – ähnlich einem barocken Bühnenbild – in die bestehende Struktur legte. Diese Setzung bildete die Grundlage für alle weiteren Interventionen.
Die entstandenen blockhaften Betonobjekte überlagern dabei bestehende Treppen im Aussen- und Innenraum und bilden eine darüber gelegte, monolithische Gesteinsschicht. Keine Fuge ist im Material erkennbar. Die einzigen notwendigen Brüche sind bewusst gesetzte, markante Abstände / Negativfugen gegenüber dem Bestand. Aus dem ehemals additiven, streng achsensymmetrischen Raumkonzept des Museums entstand im Foyer die horizontal gelagerte Schichtung einer bruchstückhaften Landschaft. Der Raum dehnt sich aus. Er befreit sich.»
Heike Hanada, Architektin
Ausgehend von einer markanten Struktur für das stadtseitige Eingangsportal entwickelt sich im Innenraum eine minimalistische Promenade durchs Gebäude, die sich auf die Parkseite des Museums weiterzieht. Das Projekt thematisiert die historische Treppenanlage mit Portikus und Figurenschmuck, den es mit einer minimalistischen Setzung konterkariert. Die «Skulptur» ist zugleich Treppe, Plattform und Aufenthaltsort. Die reduzierte Formensprache setzt sich in der Gestaltung im Foyer fort und verlängert sich auf die Stadtgartenseite mit einer zweiten Treppenanlage mit integrierter Rampe. Die Akzente auf der Stadt- und Parkseite vermitteln gegen Aussen ein grundsätzlich anderes Verständnis von Museum, das nicht mehr Musentempel, sondern vor allem Begegnungsort für Menschen sein will.

Eingangshalle Kunst Museum Winterthur | Reinhart am Stadtgarten.
Foto: Reto Kaufmann
«Sämtliche Änderungen und Überlagerungen, die das Haus mit minimalen Massnahmen erfährt, basieren auf der Idee einer landschaftlichen Szenerie. Diese wird durch das Haus hindurch vom Park zur Stadt und umgekehrt geführt. Ihre steinernen Fragmente manifestieren sich im Innen- und Aussenraum. Als Artefakte suchen sie, vom Boden ausgehend, das Gegebene und das Neue miteinander in Einklang zu bringen. Jeder dieser Blöcke kann in seiner Nutzung unbehelligt Treppe, Rampe, Tisch oder Bank sein und doch gleichzeitig im Auge des Betrachtenden Teil einer romantischen Landschaftsvorstellung werden. Aus der Ferne gesehen, schmiegen sich die sich langsam erhebenden Stufen an die hohe Wand des Hauses. Die Wand hält. Sie bildet den Hintergrund für neue urbane Szenen. In der Mitte durchbricht der Beton die Wand. Das städtische Leben hält Einzug.»
Heike Hanada, Architektin
Zur klaren Formensprache der Betonobjekte setzt der belgische Künstler Koenraad Dedobbeleer mit seinen Leuchtkörpern einen spielerischen plastischen Gegenakzent und thematisiert zugleich das Licht als Grundlage der Wahrnehmung von Kunst. Zudem transformieren seine stelenartigen Leuchten das Innere in einen öffentlichen Raum und verbinden ihn so mit dem Aussenbereich.
«Die Installation im Foyer des Museums versucht, das Bewusstsein der Besucher:innen für dessen öffentlichen Charakter zu schärfen. Es fungiert als Pufferzone zwischen dem Aussenbereich und den Ausstellungshallen, als Übergangsraum zwischen der Flüchtigkeit städtischer Streifzüge und dem konzentrierten Blickpunkt eines Museumsbesuchs. Die Leuchten interpretieren das öffentliche Mobiliar, das normalerweise ausserhalb eines Gebäudes zu finden ist, neu und holen so das Aussen in das Innere des Gebäudes, wodurch der Aussenraum in den Innenraum verlängert wird. Formal orientiert sich die Installation an Elementen, die bereits im Gebäude vorhanden sind, insbesondere an Murano-Leuchten aus den 1950er Jahren. Hier wurden die Muranoglaselemente, die üblicherweise eine ausgeprägte Innenraumqualität vermitteln, umgestaltet und an eine Formensprache angepasst, die sich auf Arkaden und Aussenwege bezieht. Sie sollen die Besucher:innen dazu einladen, vorbei und nach oben in die abgeschiedenen Räume des Museums zu schlendern.»
Koenraad Dedobbeleer